Der Ballast von früher, den wir mit uns schleppen!
- diedreißigerin

- 3. Juli 2021
- 5 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Juli 2021
Seit September gehe ich bis auf ein paar Ausnahmen wöchentlich zur Therapie, anfangs neugierig und etwas unbeeindruckt, weil ich auch mit Freundinnen über Gefühle sprechen kann und ich nicht wirklich den Eindruck hatte, dass ich von diesen Gesprächen profitiere, später etwas angespannt, weil wir in sehr tiefe Gewässer vorgedrungen sind und ich schon immer Angst vorm Dunkeln hatte. Die letzten paar Sitzungen hat sich eine deutliche Veränderung gezeigt: Ich weine jedes Mal. Oft spüre ich schon im Aufzug den Kloß im Hals, hab beim Hineingehen Gänsehaut und während den Gesprächen rinnen ganz viele Tränen zu Themen und Situationen, die mir früher nichts anhaben konnten. Der Knoten ist geplatzt, die harte Schale gebrochen und es zeigen sich die Unmengen an Ballast, die ich seit meiner Kindheit mit mir herumschleppe.
Zurück zum Anfang.
In meinen ersten Stunden wollte sich meine Therapeutin einen groben Überblick verschaffen und sich ein eigenes Bild von mir und meinem Umfeld machen. Wir haben viele Themen angeschnitten, ich habe über meine Familie, Freundinnen und meinen Beruf erzählt, meine eigenen Baustellen beschrieben und über meine Erwartungen reflektiert. Dabei hat sich eines sofort gezeigt, ich steh mir selbst oft im Weg, fühl mich durch meine eigenen Muster zu bestimmten Reaktionen genötigt und möchte dieses prädiktive Verhalten wortwörtlich "loswerden". Das war meine Vorstellung, ich gehe hin, wir reden, sie präsentiert mir die Lösungen, stellt mir Aufgaben und nach einem Jahr marschiere ich geheilt und "richtig" wieder raus. Ich hatte auch im Vorfeld nie das Gefühl, eine Therapie zu brauchen, alles funktionierte, ich funktionierte und mit depressiven Verstimmungen oder Ähnlichem hatte ich in meinen Zwanzigern nie zu kämpfen. Wie denn auch, es war keine Zeit, mich mit mir zu beschäftigen, es gibt andere, die es viel schlimmer haben, ich hab nie Gewalt erfahren, war in meinem Studium äußerst erfolgreich und Therapie war in meinem Kopf für Menschen, die wirklich mit psychischen Problemen und dunklen Gedanken zu kämpfen hatten, reserviert.
Nun, zum ersten Mal hat meine Fassade vor zirka zwei Jahren zu bröckeln begonnen. Ich war erst ein paar Monate mit meinem letzten Freund zusammen, hatte mich seit langem wieder einmal jemandem geöffnet und wurde mit vielen Ängsten konfrontiert. Damals ging es in erster Linie um Familien- und Erbgeschichten, ich bin nunmal ein Scheidungskind und das werde ich auch immer bleiben und dazu noch sehr sensibel. Das macht mich in meiner Familie (Mama, Stiefpapa und Halbbruder) zur absoluten Außenseiterin. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch nicht einmal zwei Jahre alt war, ich kann mich an kein gemeinsames Familienleben erinnern und steh schon mein ganzes Leben lang zwischen den Fronten, jongliere, passe mich an und mache es beiden Teilen recht. Dazu kommt, dass ich mit meiner Familie am Land aufgewachsen bin, schon immer einen anderen Nachnamen als der Rest hatte, im Gegensatz zu den anderen dreien ein heller Typ bin und sowohl in der Volks- wie auch in der Hauptschule die einzige mit zwei Papas und vielen Großeltern war.
Es war halt so, als "glückliches Scheidungskind" wurde ich oft betitelt, die doppelten Geschenke wurden hervorgehoben und die spannenden Wochenenden mit meinem leiblichen Papa betont. Ja, ich hatte eine glückliche Kindheit, meine Eltern haben ihr Bestes gegeben und mein Stiefpapa ist der tollste Papa, den ich mir wünschen hätte können. Aber, und das habe ich vermutlich schon ganz früh wahrgenommen, ich gehörte nicht kompromisslos dazu, musste zwischen Elternteilen am Wochenende wählen und war eben das angeheiratete Kind. Das hat zu Strategien geführt, brav und strebsam zu sein, war meine oberste Priorität – das machte mich lobenswert. Schulisch stand ich immer außer Konkurrenz mit meinem Bruder, konnte kompensieren, was ihm angeboren war, ein rechtmäßiger Platz in dieser Familie, die nur zu halben Teilen meine ist. Das mag jetzt dramatisch klingen, vor allem, weil ich es heute eigentlich besser weiß, aber es zeigt sich langsam, dass manches, was ich damals einfach so hingenommen habe, mit sehr viel Trauer und Wehmut behaftet ist.
Therapie kann auch unbequem werden.
In den ersten Sitzungen wollte ich in erster Linie über meine Trennung sprechen, dort lag der ganz offensichtliche Schmerz. Die Trennung war auch der finale Auslöser, durch welchen ich mich, nachdem ich bestimmt ein Jahr davon gesprochen hatte, zum ersten Termin durchringen konnte. Dieser Liebeskummer war rückblickend nur die Spitze des Eisbergs, darunter hat sich eine Fülle an Kindheitsmustern und -ängsten verborgen, bei denen, das haben wir von Titanic gelernt, die eigentliche Gefahr liegt. Immer, wenn ich meiner Therapeutin Episoden aus meiner Kindheit erzählt hatte, waren diese frei von jeglicher Emotion, ich hab mich wie eine omnipräsente Zuschauerin gefühlt, die ihrem kindlichen Ich zusieht. Auch in Träumen war es oft der Fall, dass ich mich selbst von außen gesehen und mich bei Situationen beobachtet habe, ohne Regung und ohne Gefühl. Es hat jetzt einige Monate gedauert, bis ich meine Schutzmauer ein wenig ablegen konnte und bereit war, dorthin zu fühlen, wo es wirklich weh tut – und Alter, es tut richtig unverschämt, verdammt und überwältigend weh. Die Sitzungen sind in letzter Zeit unbequem, auf einmal sind die kindlichen Emotionen sehr präsent und ich bin, wie zu anfangs schon erwähnt, sehr viel am weinen. Das ist definitv nicht fein, aber auch sehr heilsam.
Der Ballast und seine Konsequenzen.
Bis hierher war mein kindlicher Ballast nur in meinen Reaktionen auf Impulse spürbar. Ich war mir der Tiefe mancher Emotionen, die in unterschiedlichen Situationen zum Vorschein kommen und oft nur schwer zu erklären waren, nicht bewusst. Mein größtes Thema ist sicher Zugehörigkeit. Eine größere Gruppe an neuen Menschen zu treffen, die sich alle schon kennen, ist mein Horror und löst sehr viel Unbehagen schon im Vorfeld aus. Was muss ich anziehen, um dazuzugehören, welche Musik muss ich mögen, um akzeptiert zu werden, wie muss ich mich verhalten, dass mich alle mögen. Das führt meistens zu einem sehr verkopften Auftreten und vor allem Stille – wer nichts sagt, kann nichts Falsches sagen.
Wer nicht pünktlich kommt, dem bin ich es nicht wert, wer Sachen vergisst, hat mich nicht genug lieb, wer bei Konfrontationen geht anstatt zu bleiben, auf den kann ich mich nicht verlassen, leere Worte und nicht eingehaltene Versprechen treffen einen ganz speziell empfindlichen Punkt, ebenso wie fehlendes Interesse und ausbleibende Umsorgung. Das sind alles altbekannte Situationen und Enttäuschungen, die ich als Kind auf meinen eigenen Wert bezogen habe. Viele Male schon habe ich bei derartigen Situation überreagiert, war unerklärlich fest enttäuscht und habe mich oft selbst nicht verstanden. Im Endeffekt werden Existenzängste frei, wenn mir jemand, der mir nahe steht, nicht zeigt, dass ich ihm wichtig bin und dass er mich mag, ist meine Daseinsberechtigung gefährdet. Ich bin über dreißig und mir sehr wohl bewusst, dass ich nicht vom Erdboden verschwinde, wenn mich jemand ablehnt, aber mein vegetatives System hat das noch nicht ganz verstanden und das reagiert bei oben beschriebenen Situationen immens. Übelkeitsgefühl, Gänsehaut, Appetitlosigkeit und Herzrasen sind wohlbekannte Begleiter, die mir Alarmbereitschaft signalisieren. Je näher mir eine Person steht, desto schlimmer sind die körperlichen Auswirkungen bei einer Enttäuschung.
Nur weil es so war, muss es nicht so bleiben.
Eine logische Konsequenz, denn früher habe ich mich nicht getraut zu reagieren. Wenn mein leiblicher Vater mich wieder einmal warten lassen oder sich wochenlang nicht gemeldet hat, war es eben so. Wenn meine Mama zum zigsten Mal auf der Seite meines Bruders stand, musste ich es auch hinnehmen. Mir fehlt das kindliche Urvertrauen, und die damals erfahrenen Kränkungen haben sich fest eingeprägt, wurden tief vergraben und haben dennoch unbewusst mein gesamtes Beziehungsleben bestimmt. Fuck – hab ich mir nach dieser Erkenntnis in der letzten Sitzung gedacht. Wie gemein, wie unfair, wie richtig scheiße. Die schlechte Nachricht, die Vergangenheit können wir nicht ändern und diese kindlichen Prägungen, die jetzt auf einmal sehr laut werden, gehören zu mir und machen mich aus, so sehr ich sie auch hasse und mich dafür bemitleide. Die gute Nachricht, hinzusehen und hineinzufühlen sind die ersten Schritte auf dem sehr langen Weg der Aufarbeitung. Verbannen kann ich diese Monster, die mich jetzt noch regelmäßig überlaufen, vermutlich nie, aber ich kann lernen sie an die Leine zu nehmen und selbst den Weg zu bestimmen.








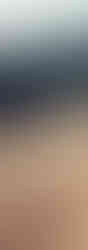













Comentários